Europa blickt fasziniert nach Osten. Kein Land treibt seine Energiewende so rasant voran wie China. Die Staatsführung präsentiert sich als Musterbeispiel moderner Klimapolitik. Doch die Realität erzählt eine andere Geschichte: Hinter der glänzenden Fassade aus Solarpaneelen lauert eine Renaissance der Kohlekraft. Der vermeintliche Fortschritt offenbart eine Wirklichkeit, in der wirtschaftliche Interessen wichtiger erscheinen als ehrgeizige Klimaziele. Diese Diskrepanz prägt das Bild einer Volksrepublik, die grün wirkt – und doch tiefschwarz atmet.
Europas Blick blendet die Realität in China aus
In europäischen Medien gilt Chinas Energieumbau als Paradebeispiel. Nach Daten der International Energy Agency (IEA) überstieg die installierte Leistung erneuerbarer Energien die Marke von 2100 Gigawatt – ein Rekord, der beeindruckt. Doch während die Energiewende im Westen gefeiert wird, fließen in der Volksrepublik weiterhin Milliarden in neue Kohlekraft-Projekte. Die Realität zeigt: Der Aufstieg der grünen Energie geht in China Hand in Hand mit dem Ausbau fossiler Energie.
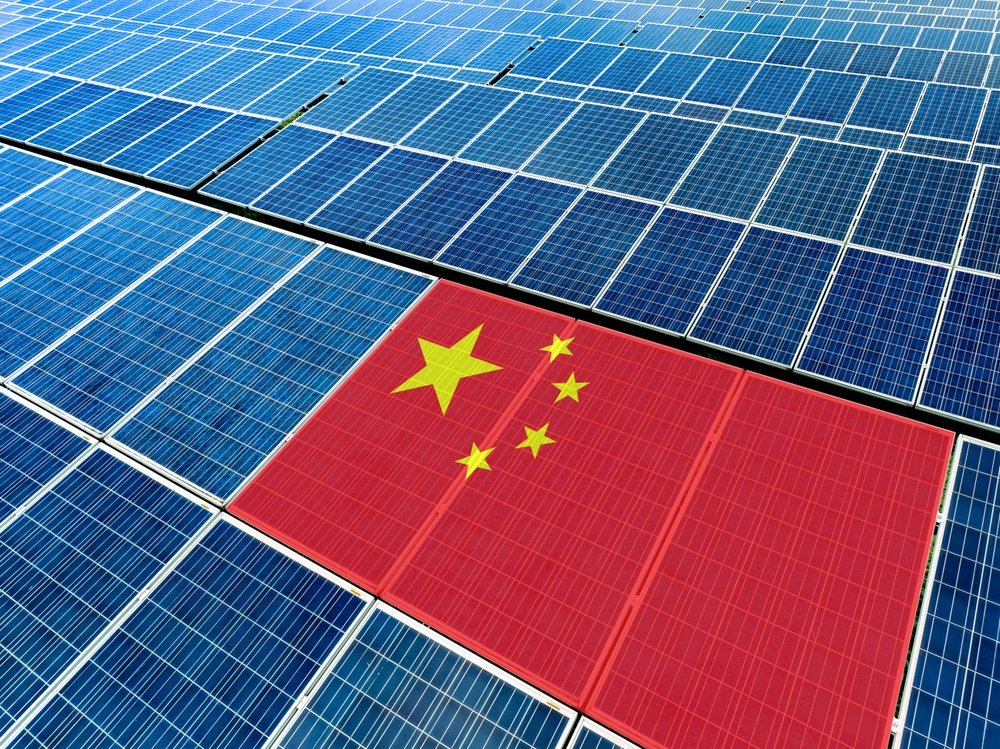
Die chinesische Führung verweist stolz auf Fortschritte, doch die Wirklichkeit bleibt widersprüchlich. Neue Solarfelder überziehen das Land, während im Hintergrund Schornsteine rauchen. Diese doppelte Entwicklung untergräbt die Glaubwürdigkeit der offiziellen Emissionsziele.
Paradoxe Energiewende im Hochland von Qinghai
Ein Blick nach Qinghai macht die Gegensätze sichtbar. Auf über 400 Quadratkilometern glänzen Millionen Solarpaneele des Gonghe-Talatan-Parks. Er liefert Energie, die dutzende Kernkraftwerke ersetzen könnte. Dennoch verpufft ein Teil der Produktion, weil Stromleitungen fehlen. Parallel entstehen neue Kohlekraftwerke. So wirkt Chinas Energieumbau grün – doch die Realität bleibt grau.
Zhang Jingang, Vizegouverneur der Provinz, pries Qinghai als „Schlüsselakteur grüner Energie“. Über 95 Prozent der Kapazität stammen dort aus Erneuerbaren. Trotzdem deckt Kohle den größten Teil des Verbrauchs. Der Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Energiesystem.
Fossile Energie als Sicherheitsanker
Offiziell zielt Peking auf Klimaneutralität bis 2060. Doch nach Stromausfällen 2021 rückte Versorgungssicherheit in den Mittelpunkt. Der Staat reagierte mit neuen Projekten im Bereich Kohlekraft. Laut einer Analyse des Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) dominiert weiterhin fossile Energie. Die Energiewende verlangsamt sich, obwohl politische Programme anderes suggerieren.
Energieexperten warnen, dass die Wirklichkeit den Klimaversprechen kaum standhält. Ohne ein modernes Netz bleibt der Ausbau der erneuerbaren Stromquellen ineffizient. Der Abstand zwischen Ambition und Realität wächst – ebenso der CO₂-Ausstoß.
Strategische Interessen statt Klimaziele
Die Volksrepublik nutzt grüne Technologien als geopolitisches Werkzeug. Über 80 Prozent der weltweiten Solarmodule stammen aus chinesischer Produktion. Diese Dominanz stärkt Chinas Einfluss und schwächt westliche Industrie. Gleichzeitig unterminiert die Überproduktion die Energieumbau-Strategie anderer Staaten.
Premier Li Qiang präsentierte den Bau des Yarlung-Tsangpo-Damms in Tibet als Symbol nationaler Stärke. Das Projekt soll 70 Gigawatt liefern, stößt aber auf internationale Kritik. Indien fürchtet Eingriffe in die Wasserzufuhr, Umweltschützer warnen vor Zerstörung sensibler Ökosysteme. Auch hier zeigt sich die Wirklichkeit: wirtschaftliche Interessen dominieren die Klimaziele.
Globale Folgen der chinesischen Energiepolitik
Chinas Energiewende beeinflusst längst andere Kontinente. Solartechnik aus der Volksrepublik stabilisiert Stromnetze in Pakistan, Südafrika und Lateinamerika. Laut Ember Energy senken diese Exporte weltweit die CO₂-Emissionen um rund ein Prozent. Doch die Produktion selbst erzeugt enorme Mengen fossiler Energie. Der ökologische Nutzen bleibt also relativ – eine unbequeme Realität.
Die fünf größten Solarunternehmen Chinas verzeichnen inzwischen Milliardenverluste. Überkapazitäten und Preisverfall bedrohen westliche Hersteller. So führt der globale Energieumbau zu einer neuen Abhängigkeit: Nicht mehr Öl, sondern Silizium bestimmt die Machtverhältnisse.
Realität statt Illusion
Chinas Energieumbau steht sinnbildlich für die Spannung zwischen Anspruch und Realität. Die Volksrepublik demonstriert technologische Stärke, gleichzeitig verfestigt sie die Kohlekraft als Rückgrat ihrer Energiepolitik. Diese Wirklichkeit bleibt unbequem, doch sie spiegelt den Zustand der globalen Klimaziele: ambitioniert auf dem Papier, widersprüchlich in der Praxis.
Europa sieht in Chinas Energiewende gern ein Erfolgsmodell. Doch wer hinter die Kulissen blickt, erkennt: Die Realität dieser Transformation ist komplexer, unvollständiger und politisch kalkulierter, als viele glauben möchten. (KOB)
Lesen Sie auch:
- Chinas leiser Griff nach der Klimabewegung – wie Peking Einfluss auf westliche Umweltpolitik nimmt
- China im Kohleboom – Rekordausbau fossiler Energien trotz grüner Versprechen
- Neuen Rekord erreicht – China hat 2024 mit dem Bau von 63 neuen Kohlekraftwerken begonnen
- Funkmodule in Solaranlagen aus China entdeckt – US-Ermittler warnen vor Sabotage
