Baden-Württemberg lebt vom Auto. Rund 225.000 Menschen arbeiten direkt im Fahrzeugbau, also in der Produktion von Autos und Teilen. Zählt man Zulieferer, Anlagenbauer und Entwicklungsdienstleister hinzu, steigt die Zahl im gesamten Automobilcluster auf fast 480.000 Beschäftigte. Kaum eine andere Region in Europa ist so stark abhängig von einer einzigen Branche. Doch schwache Märkte, hohe Investitionen in Elektromobilität und wachsender Stellenabbau belasten den Kern Baden-Württembergs.
Hersteller in Baden-Württemberg sichern Jobs, doch die Unsicherheit steigt
Mercedes-Benz betreibt in Baden-Württemberg zentrale Werke: Sindelfingen mit rund 35.000 Beschäftigten, Rastatt für Kompaktwagen und Untertürkheim als Kompetenzzentrum für Motoren und E-Antriebe. Bei Daimler Truck prägen Gaggenau mit über 6.000 Beschäftigten, Mannheim mit knapp 4.800 und Wörth am Rhein mit rund 10.300 Mitarbeitenden die Region. Diese Standorte sichern Zehntausende Jobs, doch jeder Produktionsrückgang schlägt sofort auf die Region durch.
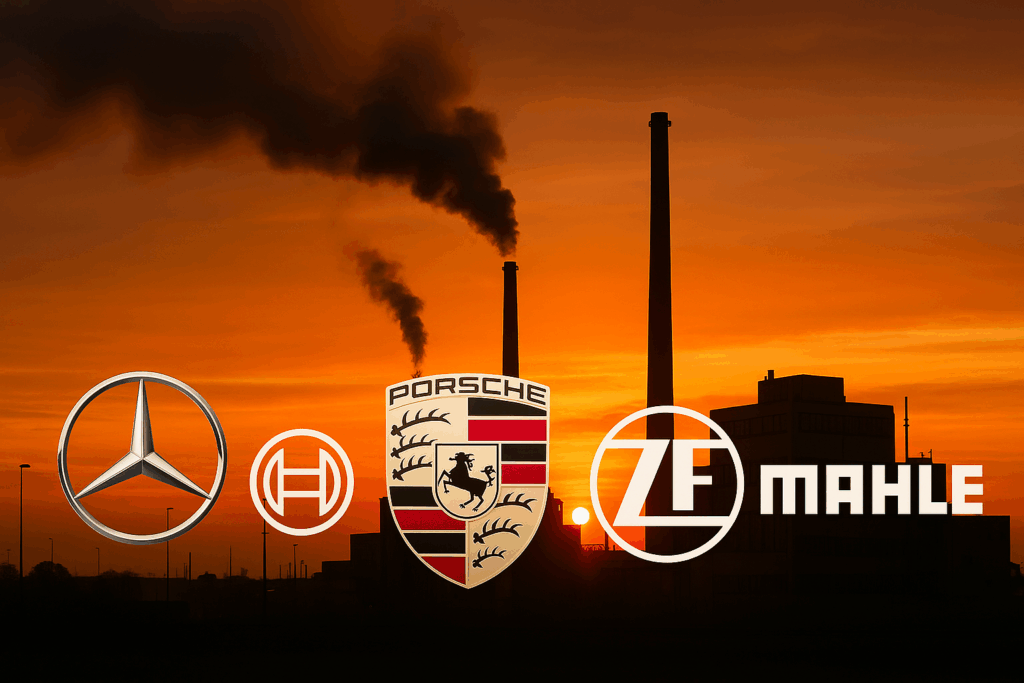
Über 1.000 Zulieferbetriebe sind eng verflochten. Bosch in Stuttgart, ZF in Friedrichshafen und Mahle in Stuttgart zählen zu den größten Zulieferern weltweit. Auch Freudenberg in Weinheim trägt erheblich zur Wertschöpfung bei. Dennoch spüren selbst diese Giganten den Kostendruck und reduzieren Programme oder Personal.
Mittelstand und Zulieferer verlieren Stabilität
Der Mittelstand bildet das Rückgrat. Boysen in Altensteig fertigt Abgasanlagen, Kauth in Denkingen liefert Befestigungen, Häring in Bubsheim produziert Präzisionsteile. „Über 1.000 Zulieferbetriebe bilden das Rückgrat der Industrie.“ Dieser Satz beschreibt nicht nur Vielfalt, sondern auch Abhängigkeit. Sobald Großkunden Aufträge kürzen, geraten spezialisierte Zulieferer ins Straucheln.
Viele kleinere Unternehmen stehen nun vor der Frage, ob sie die Umstellung auf Elektromobilität finanzieren können. Während Aufträge für Verbrennungsmotoren wegbrechen, fehlen Einnahmen aus neuen Feldern wie Batterietechnik oder Software.
Anlagenbauer spüren den Druck
Auch der Anlagenbau, traditionell stark in Baden-Württemberg, leidet. Dürr in Bietigheim-Bissingen beschäftigt am Hauptsitz rund 2.200 Menschen. Doch der Konzern kündigte an, 500 Verwaltungsstellen abzubauen, mehr als die Hälfte in Deutschland.
Andritz Schuler in Göppingen und Dieffenbacher in Eppingen spüren ebenfalls Zurückhaltung. Presswerke, Umformanlagen und Automatisierungstechnik gelten als Fundament der Autoindustrie. Doch wenn Hersteller Investitionen verschieben, geraten auch diese Unternehmen in Bedrängnis.
Entwicklungsdienstleister im Umbruch
Bertrandt in Ehningen steht für die dichte Landschaft an Entwicklungsfirmen. Rund 13.000 Mitarbeiter arbeiten weltweit für den Dienstleister, viele davon im Südwesten. Doch 2024 kündigte Bertrandt den Abbau von bis zu 1.200 Stellen in Deutschland an – eine Folge ausbleibender Aufträge aus der Autoindustrie. Erste Standorte meldeten bereits konkrete Einschnitte.
Auch andere Engineering-Dienstleister spüren die Krise. Klassische Entwicklungsprojekte für Verbrenner verschwinden, doch die neuen Felder bringen noch nicht genug Volumen, um tausende Stellen zu sichern.
Kommunen verlieren Gewerbesteuern
Die Krise trifft nicht nur Betriebe, sondern auch Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg. Stuttgart meldete 2023 Rekordeinnahmen von 1,635 Milliarden Euro aus der Gewerbesteuer. Doch 2024 fielen die Einnahmen auf rund 1,1 Milliarden Euro, 2025 rechnet die Stadt nur noch mit 850 Millionen Euro – ein Rückgang um fast die Hälfte. Allein die Zahlungen der Autoindustrie halbierten sich von 523 Millionen Euro auf 278 Millionen Euro.
Auch kleinere Städte leiden. Böblingen kalkuliert mit 20 Millionen Euro weniger Gewerbesteuereinnahmen – eine Lücke, die den Haushalt massiv belastet. Wenn Gewinne der Hersteller und Zulieferer wegbrechen, spüren es die Kommunen sofort.
Vom Vorzeigemodell zum Wackelkandidaten
Baden-Württemberg profitiert wie kein anderes Bundesland vom Auto. Doch die Zahlen zeigen, wie gefährlich die Abhängigkeit ist. 225.000 direkte Jobs im Fahrzeugbau und fast 480.000 im gesamten Cluster verdeutlichen die Dimension. Gleichzeitig verlieren Städte hunderte Millionen Euro an Gewerbesteuern.
Ohne tiefgreifende Transformation droht das Land von einem Vorzeigemodell der Industriepolitik zum Wackelkandidaten zu werden. Baden-Württemberg steht damit an einem Wendepunkt: Entweder gelingt der Sprung in neue Technologien, oder das Autoland Baden-Württemberg verliert schrittweise seine industrielle Basis.
Lesen Sie auch:
- Höchstes kommunales Defizit aller Zeiten – Städte vor dem finanziellen Kollaps
- Finanznot eskaliert: Baden-Württembergs Kommunen stehen vor dem Kollaps
- Stuttgart vor dem Absturz – wird es das deutsche Detroit?
- Massiver Einbruch bei der Gewerbesteuer – Automobilkrise reißt Loch in Stuttgarts Stadtkasse
