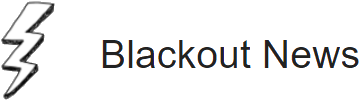Der Nordsee-Gipfel in Hamburg verkaufte Offshore-Wind als Rezept für bezahlbaren Strom. Doch schon kurz danach zerbröselte die Erzählung. Die Kosten steigen, die benötigten Netze fehlen und die Branche verlangt neue staatliche Hilfen. Die Schlagworte aus der Politik klingen wie immer größer als das, was das System liefern kann.
Nordsse-Gipfel: Große Versprechen – gleiche Wetterlage
Am 26. Januar richtete die Bundesregierung den dritten internationalen Nordsee-Gipfel aus. Dabei saßen fünf Nordsee-Anrainerstaaten, Luxemburg und die NATO am Tisch. Bundeskanzler Merz versprach bezahlbare Offshore-Energie für Verbraucher und zugleich warb er um Investitionen. Wirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche verband das Projekt außerdem mit Sicherheit, Resilienz und weniger Abhängigkeiten.

Die gemeinsame Erklärung nennt ein Ziel von bis zu 100 Gigawatt vernetzter Erzeugungsleistung. Doch genau hier beginnt das Problem, weil Offshore-Strom in der Nordsee von ähnlichen Wetterlagen abhängt. Wenn Flaute herrscht, fehlt Wind oft großräumig. Damit schrumpft der Nutzen gegenseitiger Unterstützung, obwohl die Politik ihn als Kernargument verkauft. Dennoch bleibt der Ausbauplan politisch gesetzt.
Zum Gipfel drängen sich zwei Buchtitel auf: „Vom Winde verweht“ und „Denn sie wissen nicht, was sie tun“. Diese Zuspitzung wirkt nicht zufällig, sondern sie passt zur Lage. Denn die Ankündigungen setzen auf Technikgläubigkeit, obwohl Engpässe längst sichtbar sind. Gleichzeitig ignoriert die Debatte, dass nicht die installierte Leistung zählt, sondern die verlässlich gelieferte Energie.
Branche warnt vor Zielverfehlung und greift nach dem Staat
Nur einen Tag nach dem Gipfel meldete die deutsche Offshore-Windbranche Alarm. Sie sieht das Ziel von 30 Gigawatt bis 2030 klar in Gefahr und zwar aus zwei Gründen. Erstens bremst der schleppende Netzanschluss Projekte aus. Zweitens zeigte eine Auktion im August 2025 ein fatales Signal, denn dort ging kein einziges Gebot ein.
Darauf reagierten die Verbände mit Forderungen nach einer Reform der Vergabe. Sie wollen Flächen nicht mehr nach dem höchsten Kosten vergeben, sondern nach anderen Kriterien. Das klingt nach Entlastung, doch es kostet den Staat Einnahmen in Milliardenhöhe. Außerdem fehlen dann Mittel, die man für den Netzausbau nutzen könnte. Damit verschiebt die Branche das Risiko Schritt für Schritt immer mehr Richtung Steuerzahler, während die Gewinne bei den Betreibern bleiben.
Feste Strompreise nach britischem Muster
Noch weiter geht der Ruf nach festen Strompreisen, ähnlich dem britischen Modell. Liegt der Marktpreis darunter, soll der Staat die Differenz zahlen. Liegt der Marktpreis darüber, soll der Staat zwar Überschüsse zurückbekommen, doch das Grundrisiko bleibt wieder beim öffentlichen Budget. Damit garantiert der Staat Renditen, während er zugleich die Systemkosten schultern muss. Und am Ende steigen die Stromkosten trotzdem, weil die Sicherungsmechanik viel staatliches Geld bindet.
Diese Linie macht das Gipfelversprechen „bezahlbar“ praktisch hohl. Denn wer zusätzliche Subventionen verlangt, rechnet nicht mit sinkenden Kosten. Vielmehr zeigt die Debatte, dass Offshore-Wind ohne Subventionen nicht in das politische Wunschbild passt. Gleichzeitig wächst der Druck, immer neue Instrumente zu erfinden, statt die bestehenden Fehlanreize zu korrigieren.
VKU warnt vor Planungsfehlern und teuren Systemeffekten
Am 28. Januar legte der VKU nach und griff den Ausbaukurs hart an. Der Verband kritisiert keinen Klimaschutz, sondern die Logik „mehr Gigawatt gleich billiger Strom“. Unter heutigen Bedingungen kann mehr Offshore-Leistung die Systemkosten sogar erhöhen. Deshalb zählt nicht die Zahl der Anlagen, sondern die Menge an Strom, die verlässlich und zu vertretbaren Kosten bei Haushalten und Unternehmen ankommt.
Ein Schwerpunkt der VKU-Kritik betrifft die Verdichtung auf See. Je enger Parks stehen, desto stärker wirken Wake- oder Verschattungseffekte, weil vordere Turbinen dem Wind Energie entziehen. Studien, etwa von der Technischen Universität Dresden, berichten von deutlich sinkenden Erträgen in ungünstigen Szenarien, teils bis rund 30 Prozent. Dadurch steigt der Preis pro Megawattstunde, obwohl die installierte Leistung auf dem Papier wächst. Zudem verliert Offshore-Wind einen Teil des Vorteils, nämlich hohe Volllaststunden.
Auch die Kostenseite kippt. IRENA weist in einem Kostenreport für 2024 darauf hin, dass Offshore-Wind zuletzt wieder leicht teurer wurde, unter anderem wegen Finanzierung, Lieferketten und Netzanforderungen. Hinzu kommt das Nadelöhr an Land: Ohne Übertragungs- und Verteilnetze bleibt Offshore-Strom wertlos. Laut VKU hinkt der Netzausbau seit Jahren hinterher, und zwar um rund 6000 Kilometer gegenüber den Ausbauplänen. Damit produziert die Politik erst Anlagen, und dann sucht sie Wege, den Strom irgendwie durchs System zu drücken.
Drei Tage reichen für die Ernüchterung
Der Nordsee-Gipfel zeigte damit vor allem eins: Die Regierung redet über Ziele, doch Verbände und Betreiber nennen die Bremsklötze. Innerhalb weniger Tage konterkarierten Branche und VKU die Botschaft aus Hamburg. Das wirkt besonders unerquicklich, weil es offenbar keine saubere Abstimmung mit der wirtschaftlichen Realität gab. Oder man ignorierte die Warnungen bewusst.
So bleibt am Ende wieder „Vom Winde verweht“ als treffendes Bild. Und auch „Denn sie wissen nicht, was sie tun“ drängt sich auf, wenn man die Lücke zwischen Gipfelrhetorik und Systemtechnik betrachtet. Denn ohne Netze, ohne realistische Ertragsannahmen und ohne klare Kostentransparenz läuft Offshore-Wind nicht als Preisbremse, sondern bewirkt eher das Gegenteil. Stattdessen droht eine neue Runde Umverteilung – weg vom Markt, hin zum Staat, und damit zu den Verbrauchern. (KOB)
Lesen Sie auch:
- Die Illusion vom billigem Strom durch den Ausbau erneuerbarer Energien
- Der Offshore-Windkraft-Ausbau stockt – Investoren warnen vor Renditeverlusten und Planungschaos
- Energiewendekosten – Modellrechnung zeigt Windkraft und Speicher treiben Strompreise
- Offshore-Windkraft im Wattenmeer – Risiken für ein einzigartiges Ökosystem