China nutzt seine Rohstoffmacht gezielt als Waffe – und Deutschland steht am Rand einer Versorgungskrise. Besonders kritisch ist die Lage beim Germanium, einem Metall, das für Mikrochips, Glasfasernetze, Nachtsichtgeräte und Rüstungstechnologien unverzichtbar bleibt. Ohne dieses Element drohen massive Engpässe in Schlüsselindustrien. Die geopolitische Abhängigkeit von der Volksrepublik trifft Deutschlands Hightech-Sektor ins Mark (wiwo: 10.10.25).
Exportlizenzen strangulieren den Germanium-Nachschub
Seit Mitte 2023 verlangt China Exportlizenzen für Germanium, ein Schritt, der den Nachschub drastisch drosselte. Zuvor kamen etwa 60 Prozent der deutschen Importe aus China, erklärt Rohstoffexperte Justus Brinkmann vom Beratungsunternehmen Inverto. Besonders für die Rüstungstechnologien hat diese Entwicklung gravierende Folgen, da Germanium in Zieloptiken, Sensoren und Chips steckt.
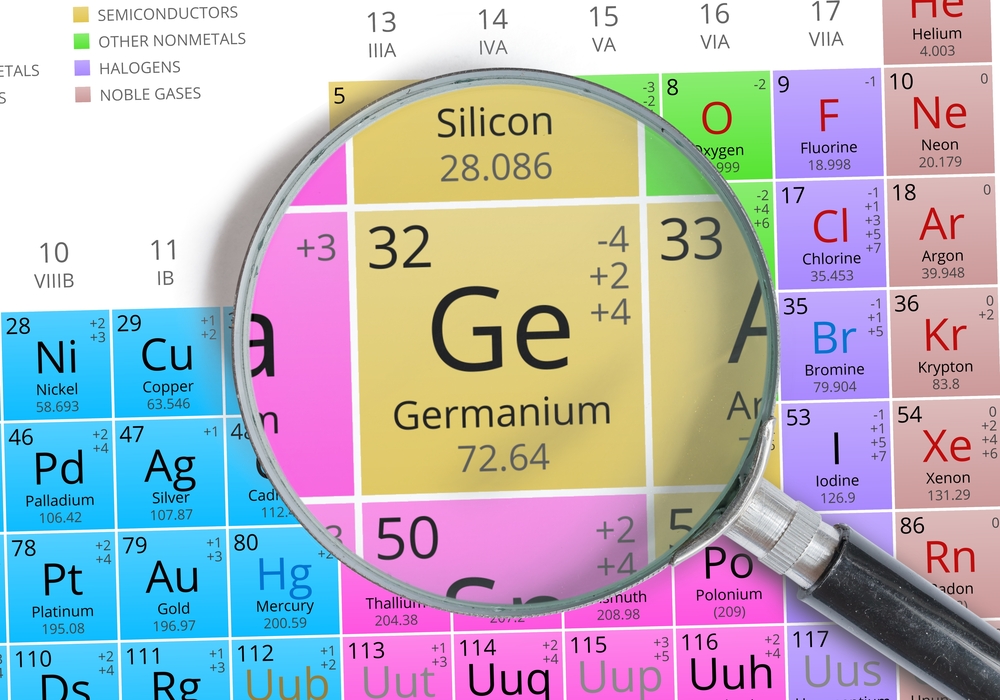
Noch im ersten Halbjahr 2023 exportierte China 28 Tonnen des Metalls. 2024 sank die Menge auf 12,4 Tonnen, 2025 auf nur 5 Tonnen. Der deutsche Anteil fiel überproportional: Nur 902 Kilogramm erreichten heimische Hersteller. Diese Knappheit zeigt, wie verwundbar Europas Mikrochips- und Glasfasernetze-Industrie inzwischen ist.
Preisexplosion auf den Rohstoffmärkten
Der Engpass löste einen dramatischen Preissprung aus. Kostete ein Kilogramm Germanium 2023 noch rund 1.500 Euro, liegt der Preis inzwischen bei fast 4.000 Euro. Laut Inverto arbeiten Beschaffungsteams mit Hochdruck an neuen Bezugsquellen, während die Industrie die enormen Kosten trägt.
Alternative Lieferländer wie Belgien, Kanada, Finnland und die USA sind ebenfalls betroffen. Lediglich der Kongo bietet begrenzte Hoffnung: Dort gewinnt Umicore Germanium aus Bergbauabfällen zurück. Diese Recyclingstrategie gilt als ökologisch sinnvoll, deckt aber nur einen kleinen Teil des Bedarfs für Nachtsichtgeräte und Mikrochips.
Deutschlands ungenutzte Reserven
Auch innerhalb der eigenen Grenzen existieren Chancen. Germanium entsteht häufig als Nebenprodukt bei der Zink- und Kupferproduktion oder lässt sich aus Braunkohlenasche extrahieren. In Deutschland lagern somit theoretische Reserven, die eine teilweise Unabhängigkeit schaffen könnten.
Forscher arbeiten an Verfahren zur wirtschaftlichen Rückgewinnung. Noch gilt das als kostspielig, doch die Preisexplosion verändert die Rechnung. Langfristige Abnahmegarantien könnten Investoren motivieren, wieder in heimische Rohstoffquellen einzusteigen. Ohne politische Rückendeckung bleibt dieser Schritt jedoch riskant.
Politik am Zug
Die Bundesregierung trägt Verantwortung, neue Rahmenbedingungen zu schaffen. Ohne stabile Förderpolitik bleibt Deutschland Spielball der geopolitischen Interessen anderer Länder. Planbare Investitionen in Recycling, Forschung und Abbau heimischer Quellen könnten den strategischen Engpass bei Germanium mildern.
Der Blick nach Afrika liefert kaum Entlastung. Das Entwicklungsministerium BMZ beschreibt den Kongo als Land mit „reichhaltigen Ressourcen, aber schlechtem Geschäftsklima“. Korruption und instabile Strukturen verhindern verlässliche Partnerschaften.
Kein Ersatz für ein Schlüsselelement
Ein Verzicht auf Germanium ist kaum denkbar. „Germanium ist wegen seiner besonderen Leitfähigkeit schwer zu ersetzen“, betont Brinkmann. Zwar entstehen neue Materialien für Nachtsichtgeräte oder Mikrochips, doch ihre Entwicklung braucht Jahre.
Die Realität zeigt: Ohne verlässliche Rohstoffstrategie bleibt Deutschlands Glasfasernetze- und Hightech-Zukunft in fremden Händen. Der Konflikt um Germanium ist längst mehr als ein Handelsstreit – er ist ein strategischer Kampf um technologische Souveränität.
Lesen Sie auch:
- Deutschlands Abhängigkeit von seltene Erden gefährdet Wirtschaft und Sicherheit
- Kritische Abhängigkeit: Die Autoindustrie taumelt wegen seltener Erden und fehlender Magnete
- Verborgene Schätze in Kohlenasche – Seltene Erden als ungenutzte Ressource
- Die dunkle Seite der Energiewende: Radioaktive Belastung in Chinas seltene Erden-Minen
